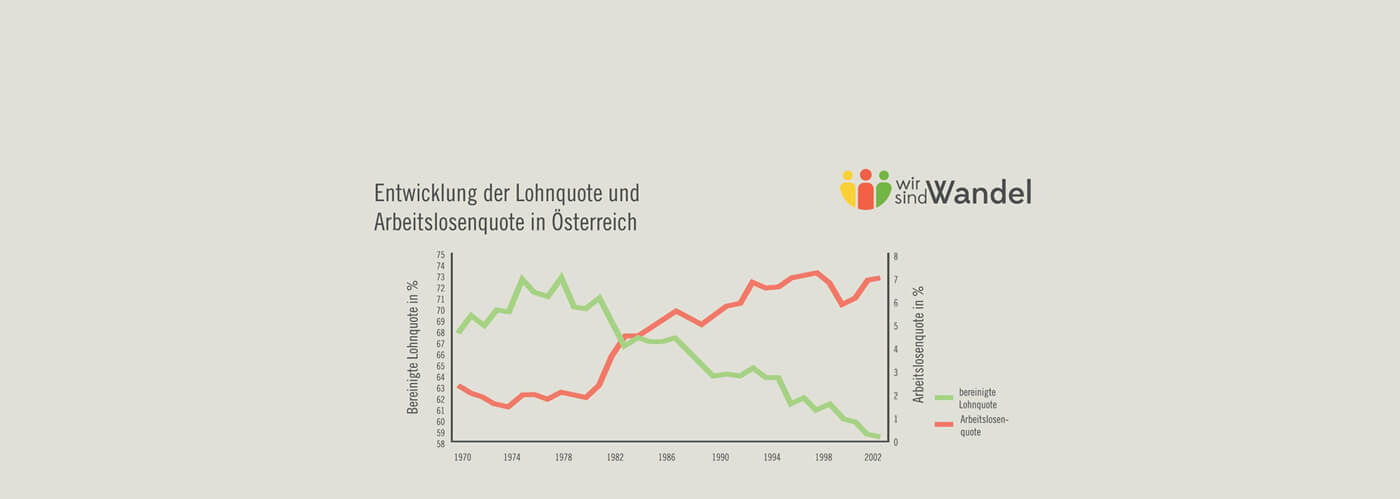Graz, 31. Oktober 2015, Seminar EUROEXIT
Die üblen Auswirkungen der Währungsunion auf die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht mehr zu übersehen. Der Schaden durch den Euro wurde allgemein sichtbar und ist nicht mehr wegzureden. Seit dies so klar ist, gibt es in der reformistischen Linken eine neue Mode: Aber der Euro ist doch nur ein Geld! Und an uns gerichtet, die wir Währungsunion und Euro als Kern der EU analysieren, dieser Politik der Austerität und des nach oben umverteilenden Neoliberalismus: Ihr seid auf den Euro fixiert! Ihr seid Fetischisten der Währung.
Ja, wir sind auf den Euro fixiert. Denn er verkörpert die Tiefenstruktur dieses Systems. Damit liegt er auch der europäischen Form der Finanzkrise zu Grunde. Über die wollen wir nun sprechen.
- „Krisen“
Krise ist ein Zentralbegriff der Neuen Sicherheitspolitik seit etwa zwei Jahrzehnten (Buzan u. a. 1998). Sie versuchte damals, von der banalen Analyse über die „Erbsenzählerei“ von Raketen und Mannschafts-Beständen weg zu kommen und einen neuen analytischen Ansatz für Konflikt-Verständnis zu finden. Den fand sie in der Krise. Krisen, so entdeckte sie, waren nicht einfach gegebene Sachverhalte. „Krisen“ müssen als solche definiert werden und sind ein Anbot der Kommunikatoren an die Bevölkerung. Dieses Anbot kann angenommen werden – oder auch nicht. Mitte der 1990er versuchte Wolfgang Schüssel, eine „Pensionskrise“ herbeizureden – und prompt verlor er damit die Wahlen von 1995.
Warum aber werden „Krisen“ definiert und angeboten? Krisen sind per definitionem, Ausnahmezustände. Ausnahmezustände aber erfordern zu ihrer Bewältigung außerordentliche Mittel. Es braucht den Einsatz von Maßnahmen jenseits der legalen Routine. Krisen legitimieren also Notstandsmaßnahmen. Krisen sind Einladungen an „Männer der Tat“. Sie bieten die Gelegenheit, Politiken durchzuziehen, die sonst weder in der Bevölkerung noch auch im politischen Instrumentarium eine Chance hätten. Carl Schmitt, Kronjurist der Nazis hat dies zugespitzt und gleich die entscheidende Frage gestellt: Wer wen? „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand befindet“. Krisen sind also die Gelegenheit, sich der Souveränität, d. h. der Staatsmacht zu bewältigen.
Der offene Staatsstreich ist aber heute nicht mehr die einzige Form, die Krise zu beenden. Heute sucht man nach Möglichkeit nach einer formal-legalen Lösung. Doch auch für sie bieten Krisen die Möglichkeit schlechthin. Dies gilt umso stärker, wenn die Krise nach allgemeinem Urteil echt und umfassend ist.
So war denn auch die Finanz- und Euro-Krise die Gelegenheit schlechthin für die Finanz-Eliten und die EU-Bürokratie. Sie und die ihnen devot untergeordneten nationalen Politiker haben diese Krise auch gründlichst genutzt. Heute hat und ist die EU eine andere Struktur als noch 2008. Und bei dieser Gelegenheit sollten wir auch an die scheinbar unlösbare „Flüchtlings“-Krise von heute denken.
Vor diesem Hintergrund müssen wir die Frage der Finanz- und Eurokrise sowie die Problematik der Währungsunion als Ganzes bedenken.
- Die „Optimale Währungsunion“ (OCA – Optimal Currency Area)
Oskar Lafontaine und einige seiner politischen Gesinnungs-Genossen wollen heute die WU auflösen, weil sie die sozial schonende Anpassungs-Politik im Rahmen eigener Währungen verhindert, insbesondere durch die Unmöglichkeit von Ab- und Aufwertungen.
1958 schrieb der britische Ökonom Robert Mundell einen kurzen Aufsatz: „Optimal Currency Area“. Auf ziemlich formalistische Weise versuchte er Kriterien festzulegen, welche den Umfang eines Währungsgebiets abgrenzen sollten, und konzentrierte sich dabei auf die Inflationsrate. Das ist ziemlich fetischistisch. Sind doch Inflationsraten und die Unterschiede zwischen ihnen nur Indikatoren für Differenzen in der Produktivitäts-Entwicklung. Aber dieser Ansatz traf den Nerv der orthodoxen Ökonomie und dominierte ihn für lange. Daran definierten Ökonomen einerseits, Politiker andererseits ihre Haltung zur WU.
Es waren vor allem orthodoxe Ökonomen in der BRD, die sich in der Phase der Planung und Vorbereitung auf die Währungsunion sagten: Die EU, bis 1995 auf 15 Mitglieder angewachsen und absehbar in der weiterer Ausdehnung, enthält Volkswirtschaften ganz unterschiedlichen Entwicklungsstands und unterschiedlicher Wachstumsgeschwindigkeit. Da gibt es Griechenland, Portugal und Spanien; aber da finden sich auch die BRD, Österreich und die BeNeLux-Länder. Sie ist also mit Sicherheit keine OCA. Eine Einheitswährung wäre unverantwortlich. Sie würde alle schädigen.
Das war somit ein orthodoxes, ja ein konservatives Argument. Es baut auf der Norm von der absoluten Dominanz des Markts auf. Das heißt keineswegs, dass ihr Argument nicht richtig ist. Aber es hat Voraussetzungen und es hat eine bestimmte Vision, wie die Weltwirtschaft aussehen soll. Wir argumentieren also in einer Linie mit H.-W. Sinn, wenn wir uns allein auf die OCA abstützen. Das macht, wie schon gesagt, das Argument nicht falsch. Aber es macht nachdenklich.
Auf der anderen Seite standen fast alle Politiker. Im Grund bestritten auch sie die Feststellung nicht. Aber sie zogen andere Konsequenzen daraus. Sie sahen die Rigidität als ihre Chance. Wenn nationale Wirtschaften nicht mehr abwerten konnten, wenn sie bei der Produktivität ins Hintertreffen kommen, dann ist das ein mächtiger Hebel, sie auf den Weg der Tugend zu bringen. Denn dann sind ihre Löhne zu hoch und müssen gesenkt werden. Der Lebensstandard der Arbeitenden muss sinken. Sie nannten und nennen es „innere Abwertung“. Und das schrieben sie in die Entwürfe und Verträge und machten es somit verbindlich für die WU-Mitglieder. Denn erinnern wir uns: Die Währungsunion ist keine Option, sie ist für die Mitglieder der EU verbindlich, sobald diese bestimmte Bedingungen erfüllen, die berüchtigten Maastricht-Kriterien nämlich.
Hier wird also ein praktischer Primat der Politik statuiert und verfolgt. Der steht dem maoistischen Voluntarismus der 1960er in nichts nach. Aber noch gibt es den ausschließlich von oben nach unten strukturierten europäischen Staat nicht, der dafür Voraussetzung wäre. Ohne den aber funktionierte dies nicht. In dieser Weise verlief die Debatte bis 2007.
In den Jahren bis dahin hatten sich aber innerhalb der Währungszone die Widersprüche akkumuliert. Bis dahin hatten die schwächeren Wirtschaften des Olivengürtels ihre abnehmende Wettbewerbskraft mit billigen Privat- und Staatsschulden überpflastert (Niedrigzinsen auf Grund der bail-out-Erwartung seitens der Banken). Dann aber kam ein unerwarteter Schock: Die steigende Ungleichheit in den USA und der Versuch, sie mit Konsumkrediten zu verdecken, führte dort zur Finanzkrise und zu Bank-Zusammenbrüchen. Sie wurden rundum als systembedrohlich empfunden. Die Kreditgeber gerieten in Panik und begannen, auch in Europa schärfer hinzusehen. Und damit gerieten vor allem die Südländer in Bedrängnis. Nun stellte sich heraus: In der OCA-These war mehr an Wahrheit enthalten, als die Politiker bisher zugestehen wollten. Das stimmte umso mehr, als die Voraussetzungen dieser These in der Zwischenzeit ausgebaut wurden: die Dominanz der Finanzmärkte in einer deregulierten Welt an erster Stelle.
Denn die EU verfolgte eine widersprüchliche Politik. Auf der einen Seite war eine radikale Deregulierung der Märkte, und vor allem des Finanzmarktes das deklarierte Ziel. Das ist die Grundpolitik zugunsten der Stärkeren. Auf der anderen Seite war die Bürokratie aber gewillt, mit allen ihr verfügbaren politischen Mitteln die Mitglieder auf eine bestimmte Wirtschafts- und Fiskalpolitik hin zu drängen. Überdies übersah das bürokratische Zentrum Brüssel in seiner Abgehobenheit, dass die nationalen politischen Klassen noch immer von der Zustimmung ihrer jeweiligen Bevölkerung abhängig waren. Folge war eine drastische Verschuldung der Haushalte im Süden, und auch die Staatsschulden begannen dort zu steigen.
Denn die Politiker dort wollten in ihrer Verblendung aus Image-Gründen die Währungsunion, obwohl sie ihre Länder ruinierte. Aber gleichzeitig – und das ist wichtig für die künftige Beurteilung – mussten sie noch Rücksicht auf ihre Bevölkerungen nehmen. Sie begriffen ganz gut, was ihnen passieren würde, wenn sie das nicht täten – und mittlerweile ist es ihnen passiert: Alle Regeierungen, die sich auf die Austerität einließen, sind davon gejagt worden, und einige dieser damals großen Parteien sind praktisch überhaupt von der Bildfläche verschwunden. Die Regierungen wollten also beides tun: Währungsunion und Menschen zufrieden stellen.
Aber nun drehten die Kreditoren plötzlich den Geldhahn zu. Die Finanzkrise wurde zur Eurokrise, und diese wandelte sich mit der Politik des Abwürgens der peripheren Wirtschaften zur Staatsschulden-Krise. Das bot die Gelegenheit. Anfangs hatte die Finanz- und Euro-Krise die Eliten besorgt gemacht, und es gelang ihr, diese Sorge an die Bevölkerung weiter zu geben. Nun zögerten sie nicht und griffen zu. Der Fiskalpakt, das europäische Semester, die Entmündigung der nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik ist heute eine Tatsache, herbei geführt von diesen Versammlungen der nationalen politischen Klassen, in ihren Vereinigungen in den Europäischen Räten.
Darüber hinaus nützte Deutschland seine Chance als Hauptinteressent der „neuen“ Politik und Zwingherr des neu-alten Europas. Südeuropa sowie Irland wurden zu Protektoraten der EZB und, im Hintergrund, von Berlin. Sie bekamen ihre Politik im Detail vorgeschrieben. Als historisch Interessierter ist man ständig an das 19. Jahrhundert erinnert: an das britische Protektorat Ägypten; an das schein-selbständige Griechenland von 1895; an Südamerika.
Aber auch die Länder des Zentrums wurden einer Transformation unterzogen. Der sogenannte Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde auch für sie verpflichtend und in kürzester Zeit durchgepeitscht. Die Länder verloren ihre Budget-Hoheit und damit das Kernstück bisheriger nationaler Demokratie.
- Imperialismus, Ultra-Imperialismus, Supra-Imperialismus, neues Imperium
Das politische Weltsystem besteht aus Staaten, nicht aus Märkten. Diese Staaten und ihre Regierungen sind die eigentliche Interessen-Bündelungen ihrer jeweils hegemonialen Klassen. Früher benutzte man den etwas altmodischen Ausdruck: Gesamtkapitalist. Das ist keine gewissermaßen beliebige Entwicklung. Die kapitalistische Arbeitsteilung, mit so viel Liebe von Adam Smith beschrieben, erfordert als Komplement die Arbeits-Vereinigung. Regulierung erfordert das System und Netzwerk einer abgegrenzten Wirtschaft. Das ist eine unumgängliche Notwendigkeit für die hochproduktive moderne Wirtschaft, und sie wäre es auch jenseits des Kapitalismus.
Im Kapitalismus allerdings stehen die so organisierten herrschenden Klassen einander als Konkurrenten gegenüber und führen den Kampf um den jeweiligen Anteil am Mehrwerts auf globaler Ebene. Das neu entstehende Weltsystem ist somit ein System der „feindlichen Brüder“. Der Einsatz des Staats-Apparats mit seinen politischen und auch militärischen Mitteln ist somit unvermeidbar, wenn dieser Apparat die herrschenden Klassen organisiert und verkörpert. Der Imperialismus wird zum höchsten Stadium des Kapitalismus.
Aber die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Die Vernetzung geht weit über den nationalen Bereich hinaus. Es lag daher nahe, dass Beobachter sich fragten: Wird dieser teils irrationale Kampf bis aufs Messer ewig andauern? Liegt nicht ein Ausgleich, eine friedliche Vereinbarung nahe? Das war die Idee des Karl Kautsky (1914).
Kautsky sah einige Entwicklungen in seiner Zeit und suchte, sie auf seine oft fast peinlich plumpe Weise zu erklären. In der marxistischen Tradition wird nicht selten das Vokabel Vulgärökonomie verwendet, um eine oberflächliche Theorie-Bildung etwa i. S. der Neoklassik zu kennzeichnen. Nun, Kautsky ist ein Musterbeispiel von Vulgärmarxismus in seltener Klarheit. In ähnlicher Weise versuchten dann die Leute des Cunow-Kreises einen proletarischen Imperialismus zu rechtfertigen.
Es ging vor allem um die Tendenzen möglicher kapitalistischer Zusammenarbeit seitens des Monopolkapitals im globalen Maßstab. Doch für Kautsky war kennzeichnend, wie oft und prominent die Wendung auftaucht: „Rein ökonomisch betrachtet…“ Er hat ganz im Sinne der Zweiten Internationale, der dann von Stalin in die Dritte Internationale hinüber gezogen wurde, den Zusammenhang von Politik und Ökonomie und ihre gegenseitige fundamentale Bedingtheit in keiner Weise begriffen. Lenin (1916) hatte es leicht, in seiner kompromisslosen und auch groben Art diese Idee, die 1914 so eklatant widerlegt wurde, ins Lächerliche zu ziehen.
Eine ähnliche Geschichte ist auch der Versuch, den Imperialismus aus der Beziehung von Industrie und Landwirtschaft zu erklären. Hier argumentiert Kautsky schlicht und einfach physiokratisch. Den Doppelcharakter der Ware bzw. der menschlichen Produktion insgesamt in ihrer Abhängigkeit von der Stofflichkeit der Natur und von der gesellschaftlichen Organisation macht er zu einer Priorität der Landwirtschaft vor der Industrie. Usf. – Lenin allerdings übersah in seiner Polemik die Tendenzen, die tatsächlich vorhanden waren, die allerdings noch einige Jahrzehnte mit Ansätzen zu ihrer Verwirklichung auf sich warten ließen. Verantwortlich dafür war sein fast mystisches Staatsverständnis. Es hinderte ihn zu erkennen, dass politische Steuerung und Staats-Elemente zum Einen durchaus von einer eigenen Kategorie von Personen, der Bürokratie, bedient werden, und diese eigene Interessen entwickeln lassen. Zum Anderen können diese Steuerungs-Instrumente auf mehrere Ebenen verteilt werden. Und das ist für unser Thema entscheidend.
Lenin überging in seiner Polemik die Tendenzen, die tatsächlich vorhanden waren, die allerdings noch einige Jahrzehnte mit Ansätzen zu ihrer Verwirklichung auf sich warten ließen. Verantwortlich dafür war sein fast mystisches Staatsverständnis. Es hinderte ihn zu erkennen, dass politische Steuerung und Staats-Elemente zum Einen durchaus von einer eigenen Kategorie von Personen, der Bürokratie, bedient werden, und diese eigene Interessen entwickeln lassen. Zum Anderen können diese Steuerungs-Instrumente auf mehrere Ebenen verteilt werden. Und das ist für unser Thema entscheidend.
Der Ultra-Imperialismus Kautsky’scher Prägung hat nicht begriffen: Es braucht eine autoritative Zwangs-Organisation, um diesen Ausgleich zwischen den nationalen Klassen zu verwirklichen. Es braucht einen übernationalen Staat. Wird aber ein solcher aufgebaut, dann wandelt sich das Konzept des Ultra-Imperialismus zum Konzept des Supra-Imperialismus. Der hat einen äußeren und einen inneren Aspekt. Wir wollen uns hier hauptsächlich um den Inneren kümmern. Denn als übernationaler Staat wird nun eine neue Struktur aufgebaut: das trans- und übernationale Imperium.
Wir haben dieses Konzept schon einige Male diskutiert, und wir sind uns nicht völlig einig darüber. Ich will auch heute die Debatte nicht in Einzelnen aufnehmen. Wichtig erscheint mir, und hier stimmen wir überein: Auch im Supra-Imperialismus hört die Dominanz der mächtigsten nationalen Kapitalgruppen nicht zu wirken auf. Unter dem Schein des Übernationalen setzen sich also die nationalen Interessen der wirtschaftlich und politisch Stärksten durch. An sich ist dies geradezu eine Banalität. Aber die globalistischen Intellektuellen sind so blind, dass sie dies nicht sehen bzw. nicht sehen wollen. Dabei ist das die maßgebliche Stellung der heutigen Rolle der BRD im Rahmen der EU. – Heute geht es mir um die spezielle Funktion, welche der Euro in diesem Zusammenhang einnimmt.
- Die Konsequenzen
Der Euro ist die Zwangs-Konstruktion, welcher die Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft i. S. der Kapital- und Finanz-Oligarchie durchsetzt. Die Logik dahinter ist die Idee eines Automatismus. Noch will man den Parlamentarismus erhalten, noch will man die „Demokratie“ als Schumpeter’sche Auswahl des Führungs-Personals – welches idealiter dieselbe Politik zu vertreten hat – nicht abschaffen. Es hat in den letzten 70 Jahren zu gut funktioniert und Stabilität hergestellt, als dass man auf dieses wunderbare Instrument verzichten möchte. Wie lange dies hält, ist freilich eine andere Frage. Gerade eben gibt es in Portugal eine Entwicklung, die man nur als Putsch kennzeichnen kann, und selbst bürgerliche Zeitungen nennen dies mittlerweise so (Telegraph vom 28. Oktober 2015). Neu ist es nicht. Der italienische Staatspräsident bis vor einem Jahr, Giorgio Napolitano, hat dies die ganze Zeit seines Amts so gespielt. Die Kunst ist es, den Schein der Legalität zu wahren, was allerdings dem Portugiesen Cavaco Silva nicht mehr so recht gelingt.
Aber durch Wahlen bestimmte Politiker sind nicht unabhängig genug, wie etwa Zentral-Banker oder Brüsseler Kommissare. Wir sahen es schon: Sie wollen ihre Posten behalten und kommen so immer wieder in Versuchung, den Bedürfnissen der Bevölkerung doch ein wenig nachzugeben. Es müssen also Strukturen geschaffen werden, welche die geforderte Politik weitgehend mechanisch garantieren. Das ist der Euro, der neue Gold-Standard.
Aber bitte keine Illusionen! Der € funktioniert nicht von selbst und allein. Daran hängt ein ganzes Institutionen-Gefüge. Es ist nicht die EZB allein, obwohl sie wie eine Spinne mitten im Netz sitzt. Der Umbau mittels des Fiskalpakts hat gezeigt, dass die Institutionen viel kapillarer sein, dass sie vom Zentrum aus kontrolliert werden müssen.
Damit sind wir aber beim Kern der Frage. Ein Rückbau des Euro zum EWS und seiner – revidierbaren – „Schlange“, dem Kursgitter, ist sicher ein wichtiger Schritt. Aber damit baut man den Rest der mittlerweile sehr engen Zwänge noch keineswegs ab. Die Argumentation von der OCA her ist also zwar notwendig und richtig. Aber sie reicht bei weitem nicht mehr aus. Das ist heute nicht mehr der Kern des Problems.
Wir müssen an die Stelle des neoliberalen Primats der Politik für die Finanz-Oligarchie einen ganz entgegen gesetzten Primat der Politik setzen. Der aber lässt sich nicht durchsetzen, wenn wir nicht den Internationalismus dieser Finanz-Oligarchie aufgeben, nein: brechen. Der Internationalismus des Kapitals und seiner Handlanger kann nur durch eine Renationalisierung gebrochen werden.
Das Wort Renationalisierung und überhaupt Nation ist für liberale Intellektuelle insbesondere im deutschsprachigen Raum gewöhnlich ein Schock. Leider trotten die Nachtrapp-Politiker der Linken und die meisten ihrer Intellektuellen in kulturellem Schafsgehorsam hinterher. Wir müssen es also erklären. Das Problem ist nicht zuletzt eine Frage der Begrifflichkeit, ja sogar der Worte. Wir vertreten keineswegs einen integralen Nationalismus. Worum es geht, das sind überschaubare Grenzziehungen, und die muss man theoretisch nicht nach nationalen Kriterien vornehmen. Etwas abstrakt formuliert:
Nationale Zugehörigkeiten sind zwar für sehr viele Menschen, für einen Großteil der Bevölkerung, eine wichtige Motivation. Aber sie sind doch in ihrer sozialen und ökonomischen Funktion eine Oberflächen-Erscheinung. Die Tiefenstruktur erfasst dies nur unzulänglich. Grenzziehungen zwischen Gesellschaften, um soziale Systeme und politische Einheiten mittlerer Rechweite herzustellen, sind wesentlich für Partizipation und bewusste, demokratische Selbstbestimmung. Zwischen dem Lokalen und Regionalen auf der einen Seite, den Lebenswelten des Alltags, und dem Mondialen und Globalen auf der anderen Seite, den inzwischen in Vielem bestimmenden Über-Einheiten, braucht es verstehbare und beeinflussbare Größen. Erst das wird eine Politik möglich machen, welche wieder der Bevölkerung Einfluss gewährt. Diesen Aspekt müssen wir in den Vordergrund schieben. Dafür sind allerdings Grenzen zwischen den Gesellschaften nötig. Grenzen aber können keineswegs undurchlässig sein. An sie knüpfen sich auch Identitäten. Sie müssten aber nicht ethnisch oder national sein. Faktisch sind solche Zugehörigkeiten gegenwärtig in aller Regel national. Der Nationalstaat ist also keine chauvinistische Lärmorganisation. Er ist eine politische Einheit, eine abstrakte Gemeinschaft mittlerer Größenordnung, welche den Menschen u. a. die Zumutbarkeit des Teilens miteinander näher bringt.
Die nationalen Grenzen haben zudem einen Charakter, welcher die Erfahrung der Bevölkerung mit gegenseitigen Unterstützungen aufnimmt. Ich spreche vom europäischen Sozialstaat. Andere Erfahrungen hat sie in dieser Hinsicht nicht. Hier könnte eine neue Solidarisierung ansetzen, welche sich mit Aussicht auf Erfolg gegen die „europäische Solidarität“, dieses Zusammenstehen der Mächtigen in ihrer verbrecherischen Politik, stellen kann.
Und damit kommen wir von einem Schritt zum anderen.
Wir müssen endlich aus der hegemonialen Zwangsjacke des Europa-Mythos heraus. Noch immer glauben auch Politiker der Linken, sie müssten sich als „begeisterte und überzeugte Europäer“ präsentieren. „Unsere Europäische Union“ schreibt Varoufakis in seiner letzten auch deutsch verfügbaren Broschüre. So unterschiedlich klingt es auch bei Lafontaine nicht. Das ist nicht „unsere“ EU: Haben diese Leutre denn nicht begriffen, was „Europa“ heute bedeutet? Dass es das Deckblatt genau dieser Politik ist, welche sie – und wir – beseitigen wollen?
Der Euro ist der Kern der EU, jenes Paradigmas neoliberaler Politik für die Spitzen der Gesellschaft, für das Finanz- und Großkapital. Wenn wir uns vom Euro befreien wollen, so wollen wir uns damit von der EU, von diesem Europa des Supra-Imperialismus befreien. Mit dem Euro stellen wir also nicht „nur eine Währung“, „nur ein Geld“ in Frage. Mit dem Euro wollen wir uns der Zwangsjacke entledigen, die uns an einer neuen, einer alternativen Politik, einer Politik für die große Mehrheit der Bevölkerung hindert.
Albert F. Reiterer
Literatur
Buzan, Barry / Waever, Ole / de Wilde, Jaap (1998), Security. A New Framework for Analysis. Boulder, CO.: Lynne Rienner.
Kautsky, Karl (1914), Der Imperialismus. In: Die Neue Zeit 32.2, 908 – 922.
Lenin, W. I. (1975 [1916]), Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Werke 22, 189 – 309.
Mundell, Robert A. (1961), A Theory of Optimum Currency Area. In: AER 51, 657 – 665.
Mundell, Robert A. (1973), Uncommon Arguments for Common Currencies. In: Johnson, Harry G. / Swoboda, Alexander K., eds. The Economics of Common Currencies: Proceedings. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Mundell, Robert A. (1997), Optimum Currency Areas. Extended version of a luncheon speech presented at the Conference on Optimum Currency Areas, Tel-Aviv University, December 5, 1997. http://www.columbia.edu/~ram15/eOCATAviv4.html (download: 27. Oktober 2013)
Schumpeter, Joseph A. (1976 [1942]), Capitalism, Socialism and Democracy. With a new introduction by Tom Bottomore. New York: Harper & Row.